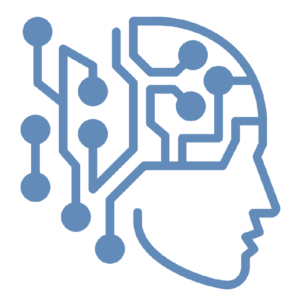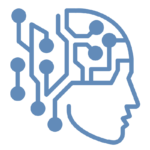BLOG
Das ewige Leben – ein „Traum“?
Die Vorstellung von einem ewigen -im Sinne von endlosem- Leben, welcher in vielen Glaubensgemeinschaften gelehrt wird, ist bei genauerem Hinsehen nicht unproblematisch. Die unhinterfragte Selbstverständlichkeit des angenommenen Segens macht so manche Unlogik unsichtbar.
Im Folgenden möchte ich einige Überlegungen anstellen, mit der diese Vorstellung überprüft und hinterfragt werden soll und spreche damit besonders Menschen an, die sich in einer kritischen Distanz zu einer Sekte oder Religionsgemeinschaft befinden bzw. einen solchen biographischen Hintergrund haben.
Ich beanspruche nicht, eine vollständige Argumentation zum Thema zu liefern; der Leser soll Anregungen erhalten und für sich weiterdenken. Oft zeigt sich erst in der extremen Zuspitzung die wahre Natur einer Sache. Dabei möchte ich keine „Beweise“ liefern, die letztgültigen Anspruch erheben. Ich möchte in redlicher Absicht zur Gründlichkeit und Ehrlichkeit mit sich selbst ermuntern, dieses grundlegende Thema neu zu durchdenken. Ich gebe zu, der Artikel ist etwas umfassend; aber wir brauchen Gründlichkeit- immerhin geht es um Leben oder Tod…
Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die sich mit der Vorstellung, der Utopie von Ewigkeit bzw. ewigem Leben befassen, sie ergründen wollen, umformen und für den Menschen greifbar machen. Schon immer sieht sich der Mensch als sterbliches Wesen in einer sterblichen Welt dem Endlosen und Ewigen (göttlichen) als polaren Gegensatz gegenübergestellt. Gleichzeitig nimmt er aber auch in allen Kulturen seinen göttlichen Ursprung an. Er scheint intuitiv zu ahnen, dass seine wahre Natur außerhalb der Zeit, also ewig ist.
Psychologisch spielt beim Blick auf ein ewiges Dasein natürlich auch die Leugnung der eigenen Sterblichkeit und damit und Angst davor eine treibende Rolle: welchen Sinn hätte das Dasein, wenn all mein Leiden, meine Mühen und Hoffnungen doch letztlich beim Tod bedeutungslos würden? Das Leben hätte keinen echten Wert, denn jeder würde es irgendwann sowieso verlieren. Auch hätte es keine eigene Tiefe, weil nur meine Subjektivität in Form meines von mir gewählten Glaubens bzw. Weltbildes über seine Tiefe entscheiden würde.
Es gibt also Gründe genug, wieso wir als Menschen die Vorstellung eines ewigen Lebens zunächst als attraktiv empfinden werden. Nun einige Vorabüberlegungen zum Thema.
Ewigkeit setzt Anfangslosigkeit voraus- oder kann Ewigkeit auch „hintendran gehängt“ werden, in eine Welt, in der alles einen Anfang hat? Ist Zeit dann noch eine relevante Größe? Es ist hier nicht der Raum, eine umfassende Zusammenfassung der möglichen Antworten darzustellen. Ich möchte in möglichst kompakter und verstehbarer Form so viele Perspektiven und Blickwinkel eröffnen wie möglich und dabei dennoch nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern Denkimpulse geben, die eine gewisse Gründlichkeit und Denkarbeit erfordern und lade dich ein, diesen spannenden Weg mit zu gehen.
Das Paradies in der Zeit
Beginnen wir also. Zeit als Organisationsprinzip lebt von der Veränderung. Die Zukunft lebt von der Potentialität der Gegenwart: was heute noch nicht ist und sein soll, wird morgen kommen. In der westlichen Welt herrscht ein lineares Zeitverständnis, d.h. die Zeit, als Ablauf der Ereignisse, bildet eine „Gerade“ mit unumkehrbarer Bewegungsrichtung. Das entspricht unserer Alltagserfahrung am besten. In diesem Sinne stellen sich viele ein ewiges Leben vor (und von dieser Zeitvorstellung gehe ich in unten stehender Argumentationen aus). Dabei ist immer ein gewisser Vorstellungshorizont gegeben, in dem sich unser Zeitverständnis und unsere Lebenswirklichkeiten wiederfinden: man kann sich sehr gut vorstellen, sein Leben sehr lange mit angenehmen Beschäftigungen zu füllen. Auch kann man sich vorstellen - um sich ein bisschen hinter den denkerischen Horizont zu bewegen - dass alles anschließend nochmal zu tun. Doch irgendwann einmal wird es schwierig: ab einer gewissen Anzahl der Wiederholungen droht doch so etwas wie Gewohnheit oder Langeweile. Also bemüht man in den entsprechenden Lehren Zustände, über die heute noch keine Aussage gemacht werden kann: Seeligkeit oder Ähnliches. Natürlich ist das sehr spekulativ. Und: in der physischen Welt, die natürliche Grenzen beinhaltet (dergestalt in der Physik und der Mathematik), muss irgendwann in der Ewigkeit jede erdenkliche Situation einmal stattgefunden haben. Alle Möglichkeiten der materiellen Existenz werden – ein ausreichend stabiles und damit dauerhaftes System vorausgesetzt – irgendwann einmal stattfinden. Und wieder stattfinden! Irgendwann einmal gibt es keine Veränderung mehr, sondern nur Wiederholung.
Die Vorstellung eines ewigen Lebens ist deshalb an ein „Paradies“ geknüpft.
Das Paradies wird in den Religionen, die eine solche Idee vertreten, auf unterschiedliche Weise verstanden. Es war einerseits einst der Urzustand des Menschen in Harmonie mit seinem Schöpfer, und dieser Zustand ist andererseits auch wieder erreichbar. Das ist entweder nach einer Umwandlung möglich, also nach dem Tode, oder aber auch innerhalb der materiellen Welt, also als verkörperter Mensch. Im Paradies ist der Mensch von jeder Agonie befreit: es gibt keinen Kampf, kein Hass, keine Angst, keine Sorgen, keine Konkurrenz, keinen Tod usw. Hier wird schon deutlich, dass ein Bild vom Leben im Paradies sehr projektiv ist, also geprägt ist vom Leben in einer Welt, die diese Merkmale unvermeidbar aufweist und sie als zu vermeidend kategorisiert: es sollte eigentlich anders sein. Und tatsächlich stoßen wir in diesem Modell auf viele Sackgassen. Ich beziehe meine Argumentation vordergründig auf die Vision eines irdischen Paradieses.
Was macht Menschsein im Kern aus?
Da wäre die Auflösung der Dualität zu nennen, die ein solches Paradies auf Dauer mit sich brächte. Alles, was wir erfahren,befindet sich in einem Spektrumzwischen zwei Polen. Dazu die vielleicht etwas provokante Frage: Was ist der Mensch ohne Leid wirklich? Wie viele charakterstarke und gefestigte Menschen kennen wir, die nicht durch schwere Krisen gegangen sind? Krisen, Probleme, Sorgen und Herausforderungen sind zentrale Elemente der Persönlichkeitsbildung und Charakterformung.
Ja, Moral und Ethik können sich nur innerhalb eines Spektrums zwischen richtig und falsch, zwischen förderlich und destruktiv, sprich: Zwischen Gut und Böse bilden. Dieses Erfahrungsfeld ist entscheidend für das Vorhandensein einer höheren Moral. „Fehler“ bilden das Material der individuellen Entwicklung eines Menschen. Mehr noch: Leid ist die Grundlage für Mitgefühl, also dem emotionalen Affekt der Liebe. Wie soll sich Liebe hoch entwickeln, wenn es aufgrund der fehlenden Polarität gar kein Betätigungsfeld mehr dafür gibt? Wenn der Mensch als moralisch denkendes und fühlendes Wesen in einem gesellschaftlichen Raum existiert, in dem es nur „das Gute“ gibt, hört er auf, moralisch zu sein. Der Mensch ist dann kein „zoon Politicon“ mehr, kein gesellschaftsbildendes, auf die Gemeinschaft bezogenes Wesen, denn das setzt voraus, dass er sich als Individuum in dieser Gesellschaft positioniert und einsetzt. Dieser Einsatz ist aber gar nicht mehr möglich, weil es kein Spektrum mehr gibt, in dem Gesellschaft sich entwickeln kann. Es existiert keine Freiheit mehr, weil keine Wahl mehr existiert. Die Welt ist nivelliert, da alles „Schlechte“ eliminiert wurde. Damit wurde auch Freiheit eliminiert. Es ist eine Welt ohne Tiefe, eine Welt ohne Entscheidungen, ohne Risiken, ohne Neugier.
Ich bin als Mensch, also als Subjekt, das fragend dem Leben gegenübergestellt ist, nicht mehr von Bedeutung, weil die Welt nur eine Antwort hat, die für alle gültig ist. Diese Antwort entstammt aber nicht authentischer, individueller Erfahrung, sondern muss stattdessen angenommen, adaptiert werden. Die Welt ist nicht mehr das Feld meiner kreativ-schöpferischen Entwicklung, sondern normierte und planierte Einheit.
Als Beispiel diene die Geschichte von Adam und Eva: hatten sie eine Wahl, als sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis nahmen? Ohne hier näher auf die tiefere Dynamik der Situation einzugehen: Die dargestellte Wahl war die zwischen Leben und Tod. Wählten sie wirklich freiwillig den Tod? Die Vorstellung des Todes war das einzig „Böse“ oder „Schlechte“ was sie zum Zeitpunkt ihrer Wahl kannten. Also kann man ohne Zweifel festlegen, dass eine Wahl (und damit Freiheit) erst möglich wurde durch die Existenz des „Bösen“. Freiheit ist ein Merkmal des Menschseins. Der erwachsene, reife Mensch kann erst durch Freiheit, gegeben durch das Vorhandenseins eines moralischen Handlungsspielraumes, in seine Verantwortung kommen und damit in sein ganzes, angelegtes Potential. Unten dazu dann mehr.
Ähnlich ist es mit der Zufriedenheit. Ist es möglich, einen Zustand tiefer Befriedigung herzustellen („Be-Friedigung“: etwas wurde be-friedet was vorher in einem Zustand des Ungleichgewichts oder Unfriedens war) ohne eine dem vorausgehende Unzufriedenheit? Ist das Fließgleichgewicht zwischen den Kräften (die Homöostase) ohne Polarität denkbar? Zufriedenheit ist das Ergebnis erfolgreicher Anstrengung auf ein Ziel hin. Diese Ziele entstehen meist aus vorangegangenen Mangelzuständen. Der Mensch ist seiner Natur nach – gemessen am Spiegel seiner Geschichte – ein Wesen, welches nach Verbesserung strebt. Er verharrt nie lange auf dem gleichen Niveau. Sich durch Versuch und Irrtum weiterzuentwickeln, ist ihm zu Eigen und erzeugt Zufriedenheit. Spannung baut sich auf, Erwartung, Aktivität entsteht, Leistung wird erbracht, Neues erschaffen. Dieser Prozess und dessen Ergebnis würden in einem ewigen, vollkommenen Zustand, in welchem sich alles auf dem Vorhandenen reproduziert, nicht mehr möglich, wie ich weiter zeigen möchte.
Man könnte fragen, ob ein Dasein alleine aus hedonistischem oder genügsamen „Satt-sein“ bestehen könnte? Lebendigkeit im menschlichen Verständnis ist mehr als eine solche Existenz: Das Suchen, Finden und Erfüllen von Zielen, die an die Einzigartigkeit des Individuums gekoppelt sind und damit ein sich Selbst immer- wieder neu- entdecken bilden, ein Hoffen, ein Wagen, das Scheitern – nicht der Ausschluss dessen, sondern seine Integration sind Merkmale anthropogener (menschlicher) Freiheit und Lebendigkeit.
Ewiges Leben wäre ein beliebiges Leben: alles wurde irgendwann schon einmal erlebt, es lässt sich wiederholen, nicht aber NEU und frisch erleben. Ein Leben, welches nicht das Ende miteinbezieht, kann keine Kontur und kein Profil mehr haben.
Tatsächliche leben wir unser Lebenvom Tod her: das Wissen um unsere Endlichkeit lässt uns das Leben wertschätzen, es tief fühlen, es mit Sinn füllen.
Das Paradies, die Utopie kann nicht stabil sein, weil die Dualität, die für bewusstes Leben nötig ist, fehlt. Jede noch so perfekt geplante und ambitionierte Gesellschaft wird mit der Forderung nach (radikaler) Dualität konfrontiert: diese findet ihren Ausdruck im Konflikt, zunächst mit sich selbst (in der Unzufriedenheit oder Sehnsucht), später mit dem Umfeld. Alles, was den Status einer Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit hat, verliert irgendwann seine Attraktivität. Das „Andere“ oder „woanders“ ist anziehender als das Vorhandene geworden: das Paradies ist quasi weitergezogen ohne mich mitzunehmen. Die Utopie ist nichts anderes, als der Wunsch des Einzelnen, ein kohärentes, stabiles und verlässliches Weltbild zu besitzen. Die Unmöglichkeit dessen zeigt sich schon in der Etymologie des Wortes: „Utopia“ ist der „Anders-Ort“, das „nicht- hier“.
Biologischer Sonderfall?
Unsterblichkeit wäre auch ein seltsames Alleinstellungsmerkmal innerhalb der übrigen Schöpfung, welche weiterhin dem Entstehen und Vergehen, Geburt und Tod unterworfen ist. Der Mensch wäre umgeben von einer Welt, die einer zirkulären Zeit folgen würde. Geburt und Sterben umgäbe das „lineare Zeitwesen“ Mensch. Alt muss gehen, damit neu kommen kann. Altes erneuert sich dadurch selbst, bleibt gleich und doch nicht dasselbe. Alles pulsiert, rotiert in Perioden, in Zyklen und würde dabei eine völlig andere Natur lehren, als diejenige, die der „ewige“ Mensch repräsentiert und erleben würde: alles fließt, nur der Mensch stünde als unbeweglicher Fels im Strom der Ewigkeit, von Ursache und Wirkung befreit. Der Mensch wäre gar kein Teil des Ökosystems Erde mehr, er würde von ihr zehren, er wäre ein Nutzer, aber kein integraler Bestandteil seiner Heimatwelt. So etwas gibt es aber in der Biosphäre nicht. Alle Teilnehmer sind physisch aufeinander bezogen. Individuelle Existenz ist abhängig von der Gemeinschaft des (sich ständig wandelnden) Lebendigen. Das Zyklische zeichnet das Lebendige aus: Menschen, die nicht bereit sind, das Alte in ihrem Leben gehen zu lassen und sich auf das Neue einzustellen, stellen sich der Erneuerung entgegen. Erneuerung ist aber integraler Bestandteil von Lebendigkeit.
Warum Pluralismus?
Eng verwandt mit dem der Dualität ist die Ambiguität. Darunter versteht man die Mehrdeutigkeit einer Sache, eines Verhaltens oder einer Eigenschaft. Ambiguität macht Individualität aus, das muss klar sein.
Eben durch Uneindeutigkeit bin ich in meinem So-Sein einzigartig, durch meine Fähigkeit, mich zu verändern, meine Vorlieben und meine Meinung. Ich bin kreativ in und mit meinem Leben. Das Leben in der Gesellschaft wird dadurch farbenfroh und vielseitig. Ohne Ambiguität ist Kunst und Literatur kaum vorstellbar. Die Faszination eines Menschen liegt ja gerade darin, dass er sich grundlegend von mir unterscheidet – in seinen Ansichten, seiner Wahrnehmung der Welt, etc. Nicht die Vereinheitlichung macht das Miteinander reizvoll, sondern die individuelle Erfahrung, die in ihrem Ausdruck keinen Zensor braucht, um sich dem Commonsense anzupassen.
Genau das aber würde geschehen, postuliert man eine Welt ohne das „Böse“. Das Individuum würde mit der Zeit unvermeidbar eingeebnet werden, unerkennbar in der Masse, irgendwann einmal identisch mit allen, dass alle irgendwann die gleichen Erfahrungen gemacht haben werden, dem gleichen Glauben anhängen, die gleichen Ansichten haben, das gleiche Verständnis aller Abstufungen des Seins haben, weil eben nur eine Lehre aus einer Quelle fließt, die verbindlich ist und keine Abweichung in der individuellen Auslegung erlaubt. Alles Innen wird zum gemeinsam konventionierten Außen. Der Konsens ist dann die völlige (und einseitige) Verabsolutierung der Welt. Persönliche Erfahrung und Wachstum erreichen irgendwann einen Punkt, an welchem sie nicht mehr erweiterbar sind. Herausforderungen, Sehnsüchte und Träume existieren dann nicht mehr.
Man könnte an dieser Stelle einwenden, dass dann ein Zustand der Harmonie erreicht sein wird, eine „unio mystica“, eine Seligkeit in Gott, die all das überflüssig werden lässt. Dann bleibt die Frage aber offen, wozu dies im menschlichen Körper geschehen muss, der ja eben für die Erfahrungen des Alterns, der Entbehrungen, der Erschöpfung und der daraus resultierenden Erfahrungsqualitäten ideal ist. In logischer Konsequenz stellt sich dann auch die Frage, warum dazu eine Ewigkeit nötig ist, die jede Erfahrung im bekannten Sinne erübrigt oder ausschließt und damit Menschsein im bekannten Sinne ad absurdum führt. Oder: der Körper ist unser Werkzeug zum Erfahrungsgewinn. Wirklichkeit und Sein stellen sich aber erst im Geist ein, unser Bewusstsein ist der Raum, in welchem Erfahrung, Identität und Leben sich abbildet und damit entsteht. Das könnte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, wo Ewigkeit tatsächlich zu suchen ist.
Entdecken, subjektives Welt-erleben, die individuelle Entwicklung von Identität und das sich-einbringen bilden und erschaffen Kultur, also Menschenwelt. In dieser finden die speziell menschlichen Erfahrungen statt. Sind diese nicht mehr möglich, weil gar keine Freiheit und Möglichkeit dazu besteht und Ewigkeit eine ins endlose verlängerte Wiederholung des Gestern ist, gibt es keine wirkliche Kultur mehr. Eine Flachland- Kultur ersetzt in ihrer gleichförmigen Einfältigkeit die Vielfalt, welche sich aus dem ständigen Erneuerungsprozess der Unterschiede bildet. Alle Lebendigkeit, die sich aus Sehnsucht, Träumen und Wünschen ebenso speist wie aus Enttäuschung oder Verlust, gibt es dann in logischer Konsequenz nicht mehr. Das Neue, das Unbekannte, Aufregende, sind Begriffe einer nie wiederkehrenden Vergangenheit. „Wer will und wer kann ich sein?“ ist keine Frage mehr, weil ich festgenagelt bin auf den Zustand der konventionell geformten Singularität. Nicht nur individuelle, sondern auch kulturelle Vielfalt könnte sich nicht mehr entwickeln.
Aber: ohne Veränderung ist Leben nicht mehr lebendig. Reifen, Wachsen, Vergehen: Leben IST Veränderung / Entwicklung. Das ist seine Haupteigenschaft, vielleicht sogar seine einzige Eigenschaft. Jede Gegenwart ist das Produkt dieses Prozesses andauernder Veränderung. Die Menschheitsgeschichte begann mit der Analogie von Adam und Eva mit der Veränderung; darüber lohnt es sich, ohne Bewertung nachzudenken.
Leben heißt eben nicht, den Tod zu vermeiden. Der Tod findet andauernd statt: Altes geht, jeder Moment geht, um einem Neuen Platz zu machen. Ich selbst kann nur lebendig sein, wenn ich bereit bin, mein altes Ich "sterben" zu lassen und damit ständig neu geboren zu werden. Damit gebe ich mich dem Leben hin. Ich erlaube dem Leben, sich durch mich auszudrücken. Damit anerkenne ich, dass der Tod Teil des Lebens ist, nicht sein Gegenteil.
Tatsächlich gibt es nichts "totes": jedes Atom "lebt". Im ganzen Kosmos finden wir nichts wirklich totes. Der Tod kann nicht das sein, wofür wir ihn halten.
"Vollkommenheit"
Leben in einem Paradies wird – als selbstverständlich genommen und ohne tiefer darüber nachzudenken - mit „Vollkommenheit“ gleichgesetzt, wobei sich diese Vollkommenheit an den oben genannten Vorstellungen orientiert: das Fehlen allen Bösen und Leid etc., ein Zustand, in welchem jeder Mangel an Tugend ausgemerzt ist und in Folge dessen auch kein Mangel erzeugt wird. In dieser Vollkommenheit ist jede Neigung und auch Fähigkeit zur (unbewussten) Fehlerhaftigkeit beseitigt. Oben haben ich schon einige Schwierigkeiten angedeutet, die ein solcher Zustand im Abgleich mit unserem gewohnten Menschenbild mit sich bringen würde. Es kann aber kaum anders gedacht werden, als dass die Auflösung individueller und kultureller Vielfalt gezwungenermaßen (im wahrsten Sinne) irgendwann einmal die Folge sein werden.
Was macht das Leben lebenswert?
Eine weiterführende Frage wäre dann nämlich die nach dem Sinn. Sinnhaftigkeit im Leben erfahren wir in unserem Dasein, wenn wir in Bewegung sind: wir erleben dabei das Formulieren (Wünschen) einerseits und das Erreichen von Zielen andererseits als sinnstiftend. Sinn ist, auf eine kurze Formel reduziert, Bewegung, während Stillstand Erfüllung ist. Ein Leben in Vollkommenheit schließt Entwicklung aus, da alle Ziele bereits (irgendwann) erreicht wurden; daher ist „Vollkommenheit“ ja erreicht (natürlich ließe sich argumentieren, dass in der Ewigkeit keine Entwicklung mehr stattfindet, wenngleich Vollkommenheit noch eine solche erlauben würde). Damit würde Sinn hinfällig, da alles Dasein reine Erfüllung wäre.
Ob das nun als erstrebenswert angesehen werden kann, kann man offen lassen; klar sollte dabei nur werden, dass „Sinn“ in seiner reinen Natur im Zustand statischer, erstarrter „Vollkommenheit“ nach unserer Definition nicht existieren kann. Man könnte wie bereits angedeutet sogar sagen, dass der Mensch ein sinnhaftes Leben von seinem Ende aus, also vom Tod aus, leben kann. Der Tod als mahnende Tatsache für meine Endlichkeit (als physisches Individuum) definiert mich, gibt mir Form, fordert mich auf, eine Haltung einzunehmen im Leben, eben eine eigene Antwort zu sein.
Gibt es dagegen ein "ewiges Morgen", welchen Antrieb habe ich heute? Ist es dann nicht völlig gleichgültig, wann ich irgendetwas tue? Dankbarkeit und Wertschätzung für das Leben – Eigenschaften, die es lebens-wert machen - speisen sich aus seiner Vergänglichkeit, nicht aus der Selbstverständlichkeit seiner endlosen Verlängerung. Alles, jeder Moment und alles, was existiert, ist eine vorübergehende Erscheinung in der Ewigkeit. Alles tritt in Erscheinung und verschwindet wieder. Das ist der Rhythmus alle Existierenden.
Wir spüren intuitiv, dass wir selbst unseren Körper „bewohnen“; er ist eine Hülle, aber kein "Oikos", kein dauerhaftes Zuhause. Auf einer tieferen Ebene wissen wir um das Exil, in dem wir vorübergehend leben, ja gefangen sind. Wir werden ihn verlassen, aber die Substanz, die diesen Körper belebt, ist er nicht selbst.
Davon abgesehen, befänden wir uns im vorgestellten Paradies nach wenigen zehntausend Jahren in einer Art Klongesellschaft: neben dem Umstand, dass es keine Kinder mehr gäbe, alle hätten irgendwann im Laufe der Ewigkeit identische Erfahrungen gemacht, hätten natürlich alle die gleichen Überzeugungen, Ansichten, die gleiche „Metaphysik“, den gleichen Wissensstand, individuelle spirituelle Erfahrungen gäbe es nicht und deshalb gäbe es auch nichts mehr zu erzählen – nirgends ein soziales Spannungsgefälle: eine Batterie in diesem Zustand wäre leer.
Ein unmoralische Angebot?
Dabei bliebe auch immer ein wenig „Unerlöstheit“, um an diesen Begriff nochmal anzuknüpfen. Der Mensch mag in einer solchen „Vollkommenheit“ gemäß unserer Definition zwar fähig sein, unterschiedlichste Ideen zu haben, doch darf bzw. dürfte er nicht allen nachgehen. Er könnte niemals verwirklichen, was aus seiner Tiefe aufsteigt, was er Kraft seiner Imagination und Kreativität umsetzen und in die Welt bringen könnte. Denn: es kann nicht alles erlaubt sein. Der Frieden ruht nicht völlig auf der Einsicht und Umkehr der menschlichen Rasse, sondern in großem Maße auch auf dem Diktat der Rahmenbedingungen für das Paradies, die- so die Theorie- von Gott festgelegt wurden.
Das Paradies ist strukturell „verordnet“. Freiheit von Leid auf Kosten der Freiheit des Individuums? Damit streife ich auch ein weiteren Punkt, den ich im zugrunde liegenden Denkmodell für fragwürdig halte und der einige Brisanz einbringt: das „Paradies“ würde letzten Endes auf Gewalt gegründet. Sein Ursprung liegt im Verbot, des unterwürfigen Gehorsams und damit der Angst vor der Auslöschung durch den übermächtigen Gott. Dieser fordert mich außerdem auf, in dieser Übermacht auch seine unbegrenzte Liebe zu sehen. Die Ambivalenz darin ist schwer überbrückbar. Diese Liebe hat nämlich paradoxerweise keinen Raum für das Potential seiner Schöpfung: alles, was der Mensch ist, ist schließlich „im Bilde Gottes“ geschaffen. Es herrscht eine völlige Abhängigkeit vom Übervater, dieser lässt den Menschen nicht „frei“.
Die Wirklichkeit und Praxis der Liebe haben wir als Menschen anders erfahren: Liebe fließt frei, wir können sie weder erzwingen, noch erzeugen, aber auch nicht verhindern, wenn sie beginnt zu fließen. Die Liebe als normative Forderung (auch nach Gehorsam) ist ein Widerspruch in sich und eine Pervertierung des Begriffs. Sie ermangelt auch der Logik des gesunden Menschenverstandes: der allmächtige Gott ist nicht als bedürftig zu denken, er braucht nichts. Wieso sollte er einen Teil seiner Schöpfung so gestaltet haben, dass er Liebe in Gehorsamsform unter Strafandrohung fordern müsste? Und dies im Zustand der „Vollkommenheit“ des Menschen, also der verheißenen Seligkeit, der Erlösung von aller Altlast? Gott hebt also den Menschen in einen quasi-göttlichen Status, hält ihn dort aber „in Schach“, unterhalb seiner Möglichkeiten und ohne echte Freiheit, welche echter Kreativität bedarf. Der Daseinszweck des Menschen wäre nun, neben seinem immer gleichbleibenden Alltagsgeschäft, „Gott zu preisen“. Auch hier ist Gott in seiner Fülle sich nicht selbst genug. Eine solche Theologie, ein solches Gottesverständnis, erscheint sehr menschlich und voller projektiver Verzerrungen. C.G. Jung stellte treffend fest: „wo Liebe herrscht, da gibt es keinen Machtwillen, und wo die Macht Vorrang hat, da fehlt die Liebe“.
Ein solches Paradies würde sich auf subtiler Gewalt gründen. In der Geschichte gibt es kein Beispiel, in welchem irgendeine Form von Zwang (also Gewalt) zu einem dauerhaft stabilen und glücklichen System geführt hat.
Die dem „Paradies“ zugrunde liegenden ethischen Normen wären die Gleichen, die seit Menschengedenken die Menschen spalten und eine Quelle des Unfriedens sind: gerade ihr Alleingültigkeitsanspruch führte dazu, dass es nicht einmal unter Anhängern Christi friedlich zuging und Einheit herrschte. Wie sollen diese Normen ewigen Frieden für die Vielzahl unterschiedlichster Kulturen und Individuen sichern können?
Adams "freie" Wahl
Gehen wir kurz noch einmal auf die biblische Geschichte der Schöpfung ein (ob wir sie wörtlich oder analogisch verstehen, ist dabei unwichtig). Gott erwartete von Adam und Eva beim Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu nehmen, eine Leistung, zu der sie gar nicht in der Lage waren: nämlich die Unterscheidung von Gut und Böse in Form von Gehorsam oder Ungehorsam. Eben diese Fähigkeit konnten sie nur durch die „Abtrennung“ vom absoluten Gehorsam erreichen; nämlich eben durch diese Tat. Diesen logischen Zirkel übersieht man gerne. Daher verwundert es nicht, dass der Baum nicht einfach ein „verbotener Baum“ war, sondern der Baum der „Erkenntnis von Gut und Böse“. Erst jetzt, nachdem sie von der Frucht dieses Baumes gegessen hatten, konnten sie Verantwortung übernehmen; vorher waren sie symbiotischer Teil des Ganzen, in welchem sittliche Autonomie – und damit Verantwortung - gar nicht möglich war.
Beachten wir: um Urteilen zu können, ob etwas böse ist, setzt dreierlei voraus, nämlich, dass das Böse 1. Überhaupt existiert, 2. von mir als Menschen als solches erkennt werden kann und 3. dass ich die Freiheit einer moralischen Wertung oder Beurteilung überhaupt habe. Ohne die Anerkennung dieser Grundlage ist jede Theologie des biblischen Sündenfalls ohne Boden.
Im erwarteten Paradies soll nun diese Fähigkeit wieder abgegeben werden; hinein in eine Regression in die völlige Abhängigkeit der Urteilsunfähigkeit von einer übergeordneten, nicht zu hinterfragenden Autorität und ein Ablegen moralischer Reife.
Was ist "böse"? Und was ist das "Böse"?
Nun möchte ich gerne noch einige Aspekte darlegen, die sich mit dem theoretischen „Rahmenbau“ unseres Problems befassen, und ich bitte den Leser, diese geistige „Dehnübung“ mitzumachen. (siehe zur Vertiefung bitte auch meine Abhandlung: Das Böse: Versuch einer Ergründung der Natur eines Phänomens).
Zunächst einmal: Wenn ich glaube, über Gut und Böse etwas zu wissen und darüber Aussagen machen zu können, dann weil diese Begriffe mit Inhalten in mir belegt sind. Es sind keine Abstraktionen oder Zuschreibungen ohne eigene Ontologie, also eine eigene Wirklichkeit. Sie sind erkennbar und in mir vorhanden, weil sie in der Welt eine Wirklichkeit besitzen. Diese Wirklichkeit besitzen sie dort, weil sie schon im Ursprung dieser Welt – in Gott – Wirklichkeit besitzen.
Der Mensch neigt grundsätzlich dazu, das Gute zu favorisieren. Er möchte die Welt nicht wirklich aufgeteilt haben in schwarz und weiß; wenn es eben irgend ginge, würde er auf das Böse verzichten und das Gute alleine behalten; daher sehnt er sich ja nach dem Paradies. Nun haben wir festgestellt, dass das Eine nicht ganz ohne das Andere existieren kann, da beides gemeinsam das Kontinuum bildet, den Raum, in dem Leben stattfindet. Auch haben wir festgestellt, dass Freiheit beides voraussetzt.
Hätte also das „Gute“ in der Form, wie es vom christlichen Standpunkt gerne interpretiert wird, tatsächlich diese Eigenschaft, würde es sich im Laufe der Zeit dank seiner Dominanz und göttlichen Qualität und Natur gegen das „Böse“ durchsetzten und es auch früher oder später auslöschen, überflüssig machen und auflösen. Es würde siegen, weil es seine Natur ist, und die Tendenz der Natur „gut“ ist, weil von Gott geschaffen und mit seinem Geist durchdrungen. Es bedürfte kaum viel Aufwand, denn das Böse wäre ein kurz aufscheinendes Phänomen, was sicher bald von selbst in sich zusammenfiele. Ganz sicher aber müsste sich das göttliche Gute nicht mit denjenigen Mitteln durchsetzen, die im Bösen verkörpert sind: Macht, Gewalt und Zwang!
Denken wir uns folgendes: Gott schuf die Welt. Musste er mit der Welt auch ethische Forderungen erschaffen? Wären diese nicht implizit in einer solchen Schöpfung enthalten? Unsere physische Existenz folgt ganz automatischen den Naturgesetzen; warum nicht also auch ethischen? Nehmen wir aber an, Gott hätte diese ethischen Gesetze, die für die Erhaltung des Guten nötig wären, doch „erschaffen“ müssen: dann braucht es eine Instanz für die Durchsetzung dieser Forderungen, eine Legislative.
Die göttliche Ethik – das Gute – stünde nicht für sich alleine, es wäre nicht von sich aus gut im Verhältnis, wie ein Tag „hell“ ist. Helligkeit muss nicht durchgesetzt, nicht ausgelegt und interpretiert werden. Damit wäre die Autorität Gottes nicht die des Guten, sondern die des Mächtigen.
Das problematische dabei ist: In der Moral ist das Gute als „Soll- Forderung“ vorhanden. Es muss nicht unter Drohung erzwungen werden. Das Gute ist ein Handlungsimperativ und kann aus sich heraus keine dem widersprechenden Folgen nach sich ziehen, wie beispielsweise Strafe. Wenn das Wohlergehen der Geschöpfe oberstes Ziel bei der Schöpfung war, kann im göttlich erschaffenen Guten nichts Böses innewohnen.
Daraus ergibt sich nun folgende zweifache Schlussfolgerung:
Ist Gott tatsächlich nur gut, muss der Lauf der Dinge im Endeffekt gut sein. Dann ist dass, was wir als „Böse“ bezeichnen, aber eine Illusion und eine Interpretation unserer Wahrnehmung. Die Welt ist, so wie sie ist, durch und durch gut. Oder aber (vorausgesetzt, er log nicht und als Nachkommen Adams und Evas können wir Gut und Böse als solche erkennen) Gott ist nicht nur gut, dann ist das Böse real und hat damit (wie alles) seine Quelle in IHM - und auch eine Berechtigung. Damit wäre wiederum unsere Vorstellung von „Gut“ unvollständig oder mangelhaft, denn unser Begriff kann in dem, wofür er als moralischer Begriff steht, nicht über Gott stehen, d.h. unser „Gut“ kann nicht „besser“ als Gott selbst sein.
Man kann also nicht in durchgängiger Logik argumentieren, Gott sei nur gut (in unserem Sinne) und die Quelle aller Dinge und gleichzeitig behaupten, seine Schöpfung besitze einen Handlungsspielraum, welcher Gegenteiliges und Gott wesensfremdes ermögliche – also das von uns so genannte „Böse“.
Damit sei auch verdeutlicht, wie schwierig es ist, ein übergeordnetes, göttlich Gutes zu definieren. Aber genau das tut man, wenn man die bestehende Welt als Böse verurteilt und ein projektiv aufgeladenes Paradies postuliert.
Der reife Mensch - ein moralisches und freies Wesen
Moralische Kompetenz ergibt sich nicht lediglich aus der Möglichkeit zum Schlechten, sondern auf einem inneren, auf Verstand und Gefühl basierenden Drang, sich dementsprechend seiner aus Erfahrung erworbenen Reife dem Leben gegenüber förderlich zu verhalten. Das ist höchste Moralfähigkeit.
Damit impliziert Moral Soll- Forderungen, die den Handlungsspielraum einerseits und die Freiheit andererseits voraussetzen. Gehorsam für sich alleine hat keinen moralischen Eigenwert. Im Gegenteil: Gehorsam isoliert von einer Ethik, die sich auf Freiheit, Reife und Einsicht gründet. Gehorsam für sich alleine ist nur Funktionieren (Beispiele in der Geschichte gibt es dafür zu genüge. Drastisch und für uns nah ließe sich der Gehorsam der Akteure im Hitler- Deutschland nennen). In einer solchen Welt, einem solchen Paradies, in welchem Gehorsam die oberste moralische Qualität darstellte, würde sich Ethik darauf reduzieren, den eigenen Willen zu unterdrücken. Ein moralisch reifer Mensch gehorcht keiner Gewalt von Außen mehr, weil seine innere Wahrheit und die damit verbundene Ethik selbt eine höhere, universelle Wahrheit widerspiegeln.
"Was ist Wahrheit?"
Dieser Ausspruch, den Pontius Pilatus Jesus gegenüber gemacht haben soll, zeugt von hoher Weisheit. Die Wirklichkeit des Lebens ist der ständige Maßstab unserer geglaubten Wahrheiten; an ihr müssen sich diese Wahrheiten über kurz oder lang messen. Unwahre „Wahrheiten“ werden nämlich zum Kampf gegen die Wirklichkeit. So gesehen, wird uns die Wahrheit durch die Dynamik des Lebens sichtbar gemacht.
Wenn die „Wahrheit“, an die ich glaube, in der Wirklichkeit überhaupt nicht anzutreffen ist, wenn ihre Prognosen nicht eintreffen, dann ist es keine Wahrheit im genuinen Sinne, sondern eine Wahrheit, die ich aus mir heraus dazu erkoren habe, eine gültige Welterklärung zu sein. Diese „Wahrheit“ passt zu mir.
Nun wechselwirke ich mit dieser Wahrheit und sehe die Welt durch diese Brille. Damit bestätigt sich meine „Wahrheit“ fortlaufend. Der Wahrheitsbegriff reicht auch nicht weit, denn wenn eine „Wahrheit“, deren Prognosen seit Generationen nicht eingetroffen sind und deren Lehren und Inhalte fortlaufend modifiziert werden (müssen), kann dem reinen Wahrheitsanspruch per Definition schon nicht gerecht werden, denn es handelt sich in Wirklichkeit dann um eine Ideologie, nämlich „an eine soziale Gruppe gebundenes System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen und Wertungen“ (Duden). Ich glaube die Ideologie nicht als Wahrheit, sondern um ihrer selbst Willen. Mein Glaube daran bezieht seine Stärke und Substanz nicht aus ihrer Evidenz (Beweisbarkeit) sondern aus meiner Zuschreibung als Wahrheit. Damit habe ich sie legitimiert, mir die Welt zu erklären. Ich habe der sich andauernd verändernden Wirklichkeit eine Schablone übergelegt, die starr ist und deshalb ständig nachjustiert werden muss.
Das ist bei Ideen (also geistigen Inhalten) zunächst auch ungestraft möglich. Sind meine Überzeugungen hinsichtlich der Naturgesetze falsch (also orientieren sich nicht an der Wahrheit) führt das mit Sicherheit zu körperlichem Schaden. Orientieren sich meine geistigen, ethischen, spirituellen bzw. religiösen Überzeugungen nicht an der Wahrheit, gereicht mir das zwar nicht sofort zum Schaden; langfristig aber kämpfe ich gegen das Lebendige und nehme Schaden an meiner eigenen Lebendigkeit. Wahrheit führt immer zu einem Plus an Freiheit. Nicht nur einer Freiheit „von“ etwas, sondern einer Freiheit zu etwas: Insbesondere zu moralischer Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit. Überall, wo Freiheit autoritär beschränkt wurde, litt genau diese Fähigkeit.
Neuanordnung der Begriffe
Wir sehen, es gibt keinen logischen Ausweg aus der Bredouille. Nehmen wir an, dass uns als Menschen ethische Erkenntnis grundsätzlich möglich ist (was wir müssen), muss diese Erkenntnisfähigkeit zur Anwendung kommen können. Dass ist in einem vorgestellten Paradies nicht möglich. Menschsein bedeutet, sich selbst erkennen im Kontext seiner Umwelt, Position zu beziehen, „Nein“ zu sagen. Ethik ist der Umgang mit der Welt und die daraus folgenden transformierenden Prozesse, die Soll- Forderungen erschaffen. Zu diesen muss der Mensch in freien Stücken gelangen. Genau das unterscheidet das menschliche Bewusstsein vom tierischen, welches dank seiner Instinkte absolut gehorsam ist und funktioniert. Dieses „Mehr“ an Bewusstheit, diese Reflektiertheit, zeichnet den Menschen als solchen überhaupt aus.
Wir erkennen auch aus unserer Lebenserfahrung, dass die Realität und die Möglichkeit des Schmerzes und des Leids einen tiefen menschlichen Wert sichtbar machen: die Wertschätzung für das Leben selbst. Menschsein ist auch verletzlich sein; genau das ist die Quintessenz vieler radikaler Erfahrungen.
Das Böse ist Teil einer moralischen Symmetrie, dem Raum menschlichen Erfahrungsspektrums und Grundlage seiner Urteilskraft. Es ist Hauptorientierung des Handelns. Um das „Gute, Schöne und Wahre“ anzustreben und zu verwirklichen, muss dessen Gegenteil grundsätzlich möglich sein. Wie kann ich mich bewusst in dem mich ständig erneuernden Prozess immer wieder für das Leben und das Lebendige entscheiden, wenn es sein Gegenteil gar nicht mehr gibt? Wie ist es vorstellbar, dass das zu Vermeidende (also das Böse) nur noch hypothetisch, als Theorie existiert und dort quasi durch Verbot unter Verschluss gehalten wird, aber dennoch mein Leben praktisch berührt?
Aus Zwang wird keine Redlichkeit. Aus Beschränkung wird keine Freiheit. Aus Einfältigkeit wird kein Glück. Aus Berechenbarkeit wird keine Herausforderung. Ohne Herausforderung gibt es keine Zufriedenheit. Liebe schließt Gewalt aus, Liebe hält Enttäuschung und Rückschläge aus und ist damit die Mutter des Glaubens und die Natur des Wandels.
Alle Aussagen, die wir aus eigener Erfahrung und aus der Geschichte über die Natur des Menschen, der das Bild Gottes ist, treffen können, widersprechen einem physischen ewigen Leben in einem Paradies. Wir müssen die Begriffe neu ordnen.
Eine Reise?
Mit unserer Geburt begann eine Reise. Wie jede Reise dient auch diese einem Zweck. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, Menschsein zu verstehen oder besser: ganz Mensch zu werden. Diese Reise führt uns durch viele Stadien hindurch, die uns sensibilisieren, formen, stärken. Wir erleben Hilflosigkeit und lernen Mut. Wir erfahren Verlassenheit und lernen Geborgenheit. Wir finden uns in der Hoffnungslosigkeit und lernen Vertrauen. Wir sind Eifersüchtig und lernen Liebe in ihrer ganzen Tiefe kennen. Wir fühlen Sehnsucht und lernen uns dabei selbst kennen. Wir sind verwirrt und wachsen an der Wahrheitsfindung. Wir erleben das Böse und finden es in uns selbst.
Indem wir all das durchleben, werden wir erst ganz Mensch. Alle Weisheit und Reife, alle Stärke und vor allem jede wirkliche Individualität resultiert aus dieser Reise. Irgendwann erfüllt sich ihr Zweck: wir kennen das ganze Spektrum menschlichen Seins, welches in seinem ewigen Gegenteil erst Sinn und Farbe bekommt. Das Schwingen, das Auf und Ab, die ewige Frequenz ist Lebendigkeit. Und wie jede Reise hat auch diese ein natürliches Ende, wenn ihr Sinn erfüllt ist. Der Kreis schließt sich, das Ende ist der neue Anfang.
Seit jeher ist Leben Wandel. Der Tod ist Symbol und Ereignis des Wandels. Alles Existierende stirbt. Erneuerung gibt es nur, wo es Tod gibt. In der Erneuerung ist Lebendigkeit. Glück ist dort am größten, wo ich Leben in seiner ganzen Wirklichkeit ohne Verzerrungen durch Wünsche oder Träume annehmen kann: das geschieht erst, wenn ich den Tod vollständig angenommen und als Teil echter Lebendigkeit integriert habe. Der Tod ist ein tägliches Angebot, denn er lässt mich bewusst, intensiv und tief leben. Er verleiht meiner Existenz Wert, statt ins endlose verlängerte Beliebigkeit.
Ein 'Ja!' zum Leben!
Zu unkritisch und leichtgläubig übernahmen wir griffige und attraktive Zukunftsbilder. Zu wenig wurde uns vermutlich deutlich, wie sehr diese aller beobachtbaren und natürlichen Ordnung widersprechen. Wir sind jetzt aufgefordert, die Ewigkeit neu zu erfassen, sie in uns zu finden, wo auch das „Königreich Gottes“ herrscht. Das ist keine Aufgabe, die leicht zu bewältigen ist. Gründlichkeit ist gefordert. Am Sterbebett wird nämlich nur eines zählen: habe ich gut gelebt? Nur der Rückblick zählt dann; Hoffnung auf ein besseres „Danach“ sind dann möglicherweise nur ein schwacher Trost ohne eigene Lebendigkeit und Glanz. Die Frage kann aber positiv beantwortet werden, wenn ich mein JETZT bewusst erlebe, ganz die Verantwortung für mich übernehme. Dann werde ich erfüllt sein, dankbar. Dann werde ich wissen, dass ich immer dem Leben zugewandt war, gewahr, offen, authentisch und präsent und damit das Gute erzeugt und gefördert habe. Das Abenteuer darf dann enden, ich darf mich in den Tod hinein ergeben.
Das ewige Leben ist kein ins endlose verlängertes physisches Dasein. Ewigkeit ist eben auch kein fassbarer Begriff für den menschlichen Verstand. Ewigkeit ist nicht einmal etwas, was wir in der materiellen Schöpfung überhaupt finden. Das bedeutet nicht, dass Ewigkeit nicht möglich ist. Ewigkeit ist aber etwas über- natürliches, Übermenschliches und über-existenzielles, etwas prä- und transpersonales. Ewigkeit ist der Urgrund unseres Seins.
Und unser Sein ist an die Verbindung zu Gott geknüpft: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. (Joh. 17,3; ELB: diese Übersetzung des Textes ist die korrekte Wiedergabe des griechische Urtextes.)
Das Erkennen Gottes und das Ewige sind eins. Die Ewigkeit ist der Gegenpol zur Zeit; damit transzendiert (überschreitet) das Erkennen Gottes das Menschsein und dessen Gebunden-sein an die zyklische Vergänglichkeit. Dazu muss ich meine jetzige Existenz aber ganz annehmen und mein Heil, mein „eigentliches Leben“ nicht in eine erhoffte Zukunft verlegen; ich muss die Existenz, wie sie sich durch mich ausdrückt, vollständig be-jaen. Der einzig reale Zeitpunkt ist die Gegenwart. Dadurch bekommt die Zeit zusätzlich zur "horizontalen" eine "vertikale" Dimension: Jetzt ist die Tiefe der Erfahrung des Lebens an sich, alles was existiert ist JETZT, alles, was existiert, ist in Gott.
Meditativ lässt sich das erfahren und formulieren wie es der große Mystiker Jakob Böhme tat:
Wem die Zeit ist wie die Ewigkeit Und Ewigkeit wie die Zeit der ist befreit von allem Streit. - Jakob Böhme, 13. Jhrd.